Die homologe
Entstehung der Lichtrezeptorzellen
Der Titel des Essays besteht aus drei Bestandteilen:
Der Homologie
der Entstehung
und
den
Lichtrezeptorzellen
HOMOLOGIE
Der
erste Abschnitt des
Essays befasst sich mit der Homologie
der Entstehung der Lichtrezeptorzellen. Es gibt zwei verschiedene Formen der Entstehung
und Entwicklung von Organen: Homologe und analoge Entstehung, wobei homolog das
Gegenteil von analog darstellt.
Analog:
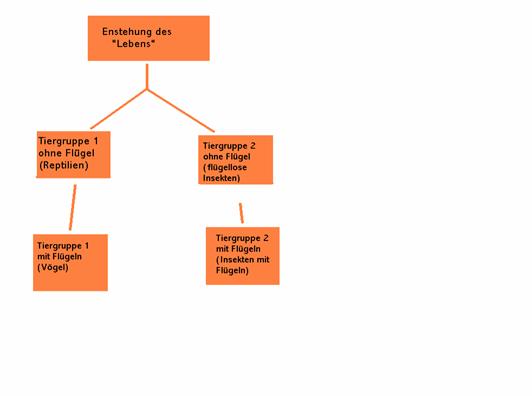
Bild
1: Analogie der Organe
Analog bedeutet, dass
Merkmale, die sich in ihrer Funktion
sehr ähneln unabhängig voneinander entstanden sind (z.B. Bild 1: Analogie der Flügel
verschiedener Tiergruppen).
Die Flügel der Vögel sind vergleichbar mit unseren Unterarmen bzw. Händen,
während die Flügel sich bei Insekten an anderen Stellen befinden; sie besitzen
sowohl Flügel als auch Beine (Arme) und sind daher vom Aufbau her nicht mit
Vögeln zu vergleichen.
Meistens
bilden sich bei verschiedenen Tiergruppen ähnliche Organe aus, weil sie
ähnlichen Umweltbedingungen ausgesetzt waren. Sie sind deshalb aber nicht
zwangsläufig miteinander verwandt.
Homolog:
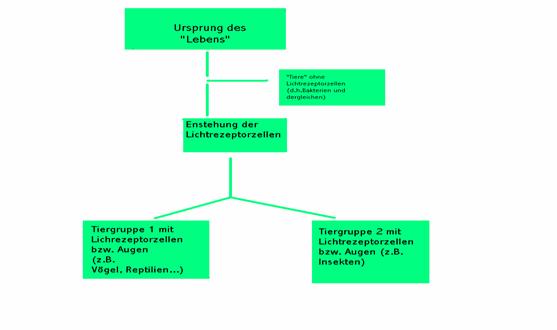 Bild 2: Homologie
der Organe
Bild 2: Homologie
der Organe
Man spricht von einer
Homologie, wenn der Aufbau zweier Organe gleiche Merkmale des selben Ursprungs
aufweist. Dies ist sowohl innerhalb einer Tierart als auch zwischen den
Tierarten möglich (Bild 2: Lichtrezeptorzellen sind nur einmal entstanden und haben sich dann
zu verschiedenen Augentypen entwickelt).
Hinweise auf eine Homologie der Organe sind die folgenden 3 Kriterien:
1. Das Kriterium der
Lage
Das Kriterium der Lage
ist gegeben, wenn die Organe die gleiche Lage im Aufbau des Körpers einnehmen
und sich auf die selbe Grundform zurückführen lassen.
2. Das Kriterium der
speziellen Qualität
Das Kriterium der
speziellen Qualität ist dann erfüllt wenn die Organe nach dem selben Bauplan
aufgebaut sind, auch wenn sie nicht mehr am selben Ort anzutreffen sind und es
zu Funktionswechseln kam. Dies kann man häufig bei Embryonen gut erkennen.
3.Das Kriterium der
Stetigkeit
Ähnliche Lage und
ähnliche Funktion deuten zwar auf eine gemeinsame Abstammung hin, allerdings
ist es während der Evolution öfters zu Anpassungen an Umweltbedingungen
gekommen, weshalb die Funktionen trotz einer Homologie voneinander abweichen
können. Die Lebewesen entwickeln sich stetig weiter, mitunter auch zurück, was
sich sehr gut verfolgen lässt.
Allerdings lässt sich
diese Homologie oft durch Zwischenformen erkennen (Fossile etc.), die von einem
gemeinsamen Vorfahren abstammen.
Quelle: Dr.
Ing. Marc Gerhard online
Fischer Abiturwissen Biologie
online
Schülerduden Biologie,
Brockhaus online
Warum
Sehen?
Der
zweite Abschnitt des
Essays befasst sich mit der Entstehung
der Lichtrezeptorzellen.
Sehr früh in der
Evolution gab es einen Punkt, an dem Lebewesen anfingen sich zu bewegen. Bevor
sie anfingen sich zu bewegen lebten sie nur an einem Ort, direkt an ihrer
Nahrungsquelle, als sie sich bewegten , mussten sie Nahrung suchen und mit
Augen war dies leichter als nur mit Geruchs- und Tastsinn. Schon der Einzeller
Euglena (das Augentieren, siehe Bild 3), der zur Fotosynthese befähigt ist,
muss in der Lage sein, Lichtquellen zu orten um die zur Fotosynthese optimal
geeigneten Stellen zu finden. Wie auch der Regenwurm ist Euglena allerdings nur
in der Lage Hell und Dunkel zu unterscheiden, was für die beiden Arten
vollkommen ausreichend ist um sich in ihrem Lebensraum zurecht zu finden. Außer
zur Nahrungssuche und der Ausführung der Fotosynthese ist der Sehsinn auch vorteilhaft,
um vor Feinden zu flüchten oder einen Sexualpartner zu finden (Nordsiek 2005).
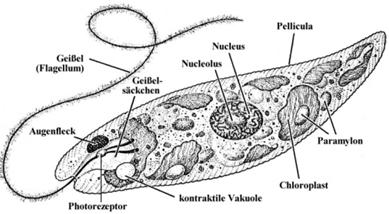
Bild 3: Euglena – Das Augentierchen,
das aus einer Zelle besteht. Sein Augenfleck dunkelt eine Seite des
Photorezeptors ab. (Krysmanski 2005)
Nun, da die Wichtigkeit
des Sehsinns außer Frage gestellt ist, ist auch verständlich wieso es zu einer
solch frühen und homologen also durchgängigen Entwicklung kam. Vorstufen der heutigen Augen entstanden schon, bevor
die Lebewesen sich zu verschiedenen Tiergruppen entwickelten. Deshalb haben
Menschen, Tiere, Vögel und Insekten alle Augen, auch wenn diese sich
voneinander unterscheiden (Satz unvollständig).
Sie haben jedoch den gleichen Ursprung. Andere Organe hingegen, wie
beispielsweise Flügel, sind erst später entstanden, als sich bereits
verschiedene Tiergruppen ausgebildet hatten.
Photorezeptorzellen
Nachdem wir sowohl
wissen, was homolog und analog bedeutet, als auch die Wichtigkeit der Entstehung des Sehens erklärt haben, beschäftigt sich der
dritte Abschnitt des Essays mit den Lichtrezeptorzellen.
Photorezeptorzellen (Synonym zu
Lichtrezeptorzellen)
sind im weitesten Sinne die Lichtsinneszellen. Sie erzeugen einen elektrischen Impuls beim Auftreffen von Licht und leiten ihn zum Gehirn. Wie man an der Larve
des borstigen Seeringelwurmes (ca. 5 cm lang, siehe
Bild 4), eines „lebenden Fossiles“, also eines Urtieres, das sich seit seiner
Entstehung kaum
verändert hat und heute noch lebt, feststellen kann, gibt es zwei verschiedene
Arten der lichtempfindlichen Zellen - im Gehirn und im Auge. (Bitte in zwei oder
drei Sätze aufspalten)

Bild 4: Seeringelwurm (Weilkiens &
Rehberger 2002)
Man nennt sie
rhabdomere und ziliäre Lichtsinneszellen. Die ziliären Lichtsinneszellen
befinden sich im Gehirn des urzeitlichen Wurmes, sie entsprechen den Stäbchen
bzw. Zapfen des menschlichen Auges und müssen daher im Laufe der Evolution vom
Gehirn zum Auge gewandert sein. Später stülpten sie sich aus und wurden somit
zu den heutigen Sehzellen. Man kann davon ausgehen, dass es die Lichtrezeptorzellen
schon beim letzten gemeinsamen Vorfahr von Wirbeltieren und Insekten gegeben
haben muss. Einige lichtsensitive Zellen sind in unserem Gehirn immer noch
vorhanden, sie beeinflussen unseren Tag-Nacht-Rhythmus und wir nehmen
Helligkeit wahr.
Quellen:
Autor, Vorname: Titel der
Veröffentlichung.- Anzahl der Seiten S., Anzahl der Auflage Aufl., Verlag,
Erscheinungsort, Erscheinungsjahr.
Falls es sich um
Internetquellen handelt siehe unten.
Im Text sind dann nur noch
Hinweise auf die Verwendete Literatur einzufügen, z.B. (Gerhard 2006),
(Krysmanski 2005), (Nordsiek 2005), (Weilkiens & Rehberger 2002). Das hat
den Vorteil, dass Interessierte (z.B. Mitschülerinnen) sich die Originalquelle
für genau die Behauptung, die ihr aufstellt besorgen können. Wenn ihr jedoch
einen ganzen Abschnitt mit 35 verschiedenen Behauptungen schreibt und dann
darunter 3 Quellen angebt, artet die Überprüfung einer Behauptung in viel
Arbeit aus.
Gerhard,
Marc, 2006, mündl. Mitteilung.
Fischer
Abiturwissen Biologie online
Schülerduden
Biologie, Brockhaus online
Krysmanski, Bernd : Das
Augentierchen Euglena.- Dinslaken, 2005, Online:
http://www.fortunecity.de/lindenpark/hundertwasser/517/Euglena.html, zuletzt abgerufen 1.3.2006.
Quelle
: Weichtiere.at
online Probiert ihre Eure Links eigentlich aus, bevor
ihr sie abgebt?
Richtiges Zitat:
Nordsiek,
Robert: Augen bei Weichtieren.- Die Welt der Weichtiere, Wien, Östereich, 2005,
Online:
http://www.weichtiere.at/Weichtiere/augen.html, zuletzt abgerufen 1.3.2006.
Schule
2002-Grundstock des Wissens (ECO Verlag)