Pigmentbecherocellen bei Planarien
Einfach entwickelte Tiere, wie die Plattwürmer aus der
Gruppe der Planarien oder die Lanzettfischchen, verfügen über Pigmentbecherocellen oder auf Gutdeutsch Punktaugen.
Diese Augen bestehen aus becherförmig gekrümmten Pigmentzellen (daher
der Name). Ocellen oder Ocelli
ist die Mehrzahl von Ocellus, was aus dem
Lateinischen kommt und „Äuglein“ bedeutet. Ocellen
sind aber keine weiteren zu erklärenden Dinge; so nennt man ganz einfach die
Punktaugen.
In Abb.1 kann man die becherförmig gekrümmten
Pigmentzellen erkennen, nämlich die mit schwarzen Punkten versehenen Vierecke. Ein
Pigmentbecherocellus besteht aus einer Reihe
aneinanderhängender Pigmentzellen, die sichel- bzw. becherförmig gekrümmt sind (vgl.
Abb. 1 die Vierecke mit den schwarzen Punkten (Zellkernen)).
Pigmentzellen sind Zellen die kein oder nur sehr wenig Licht durchlassen; Sommersprossen zum Beispiel sind Zellen mit vielen Pigmenten.
An der Innenseite der Pigmentzellen befinden sich Lichtsinneszellen (Rezeptoren; vgl. „Die homologe Entstehung von Rezeptorzellen). Sie funktionieren wie die Stäbchen im menschlichen Auge und lösen einen elektrischen Impuls aus, der an das Gehirn weitergeleitet wird, wenn ein Lichtstrahl sie trifft. Dazu müssen aber erst die Zellkörper der Rezeptorzellen durchdrungen werden.
Die becherförmig angeordneten Pigmentzellen
lassen Lichtstrahlen jedoch nur aus einem eingeschränkten Bereich durch (nämlich dort wo der Becher offen ist); so kann ein
relativ gutes Richtungssehen gewährleistet werden. Den zu durchdringenden
Zellkörper nennt man Soma (Plural: Somata); ein solches Auge, bei
dem die Somata durchdrungen werden müssen, nennt man invers.
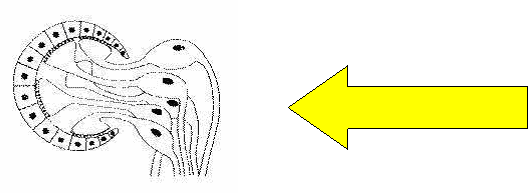
![]() Rezeptoren
(Rezeptorzellen)
Rezeptoren
(Rezeptorzellen)
Licht
Abb.1: Pigmentbecherauge und Richtung des Lichteinfalls,
die lichtundurchlässigen Pigmentzellen (das sind die Zellen mit schwarzem
Viereck) verhindern das Eindringen von Licht von hinten (ca. 280°). Die Lichtsinneszellen
reagieren dementsprechend am heftigsten, wenn das Licht aus der Richtung das gelben Pfeils kommt und genau in die Öffnung des Bechers
leuchtet. (aus Lorenz und
andere 1998, verändert)
In Wirklichkeit sieht das dann etwa so aus:
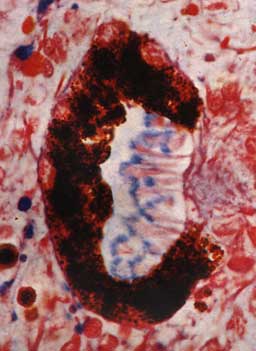
Abb.2: Schnitt durch das Pigmentbecherocellus eines
Plattwurms. (Mikroskopische Aufnahme)
Quelle: http://www.vobs.at/Bio/physiologie/a-augen.htm à online
Trifft das Licht auf die lichtempfindlichen Zellen (Rezeptoren), so wird ein kurzer elektrischer Impuls erzeugt und an das Gehirn weitergeleitet. Jetzt kann der Strudel-, Platt- oder sonstige Wurm einen Lichtfleck sehen. Da die Zellen jedoch nur Hell und Dunkel unterscheiden können, sieht der Wurm nur schwarzweiß.
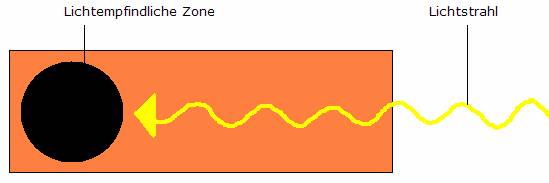
Abb.3: Die Lichtstrahlen müssen die lichtempfindlichen
Zellen (orangenes Rechteck)
durchdringen, bis sie an deren lichtempfindliche Bereiche gelangen. (invers) (Autor Jahr) (Hr. Dr.
Gerhard, 2006)
Er kann jedoch erkennen, woher das Licht kommt wenn er
mehrere Punktaugen besitzt. Jeder Rezeptor „spezialisiert“ sich auf eine
bestimmte Richtung; wenn also der Rechts-Rezeptor einen Impuls empfängt, weiß
der Wurm genau, wo sich die Lichtquelle befindet. Er kann auch Bewegungen sehr
schemenhaft erkennen.
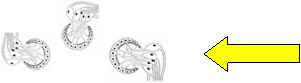
Abb.4: Zur
Erläuterung des Richtungssehens sind hier lediglich die drei Pigmentbecherocellen eines Tieres abgebildet. Während die
Lichtsinneszellen das von rechts kommende Licht (gelber Pfeil) voll
registrieren, werden die Lichtsinneszellen des Auges oben zum Teil und des
Auges rechts komplett durch den Pigmentbecher abgeschirmt. Das Tier erkennt als
die rechte Seite als die hellste und kann sich zum Beispiel nur in diese
Richtung drehen, bis der Pigmentbecherocellus oben
die größte Helligkeit anzeigt. (aus Lorenz und andere 1998, verändert)
Oft verfügen auch Gliederfüßler (Insekten, Tausendfüßler, Krebse,
Entenmuscheln, Spinnen,
Skorpione und Milben) über Punktaugen, obwohl sie zudem noch Komplexaugen
besitzen. Ocellen kommen bei sehr vielen Tierarten
vor; sie sind jedoch unabhängig voneinander (=analog) entstanden.
Eine
Weiterentwicklung der Punktaugen sind die Flach- oder Plattenaugen. Sie treten
hauptsächlich bei Quallen auf. Hier ist zusätzlich eine dicke Hautschicht
vorhanden, die als Linse dient.
Quellen: Lorenz, Katina; Karsa, Hunor S. & Bannwarth, Matthias: Schulversuche für Studierende des Lehramts, Projekt 7, Teil 1: Augentypen im Tierreich.- Universität Tübingen - ZMBP – Pflanzenphysiologie, 1998,
Online:
http://www.uni-tuebingen.de/abot/versuche/vers1.html
Online: http://www.vobs.at/Bio/physiologie/a-augen.htm
Lexikon der Neurowissenschaft,
Online: http://www.wissenschaft-online.de/abo/lexikon/neuro/1090