Sehfehler
Inhalt:
Altersweitsichtigkeit
Sehschärfe
Laser Operationen in der Augenheilkunde
Brillen und Kontaktlinsen
Augenkrankheiten
Literaturverzeichnis
Die Altersweitsichtigkeit wird im Medizinischen auch als „Presbyopie“ bezeichnet. Die Altersweitsichtigkeit ist der Verlust am Akkomodationsvermögen.
Akkomodation bedeutet, dass die elastische Linse sich von selbst wölbt. Die Zonulafasern spannen sich an, der Ringmuskel erschlafft, dadurch flacht die Linse ab. Weit entfernte Gegenstände erscheinen dadurch scharf auf der Netzhaut. Spannt sich der Ringmuskel, auch Ziliarmuskel genannt, an, erschlaffen die Fasern und die Linse wölbt sich. Dieser Vorgang erhöht die Brechkraft des Auges und nahe Gegenstände lassen sich fokussieren. Diese Fähigkeit nennt man Akkomodationsvermögen.
Mit zunehmendem Alter rückt der Nahpunkt immer weiter in die Ferne. Ab dem zehnten Lebensjahr beginnt die Linse unlösliche Eiweiße einzulagern. Diese Einweiße führen dazu, dass der Linsenkern von Jahr zu Jahr zäher wird. Die Linse kann sich bei Akkomodation immer weniger krümmen. Durch diesen Elastizitätsverlust der Linse wird es zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr schwerer Gegenstände in der Nähe zu fokussieren. Diese Form der Sehschwäche kann mit einer Brille korrigiert werden.
(Psychembel 2002, Schlagwort: Presbyopie , Markus
Bartschneider 2006, Netdoktor1)
Die zentrale Sehschärfe wird im Medizinischen auch als „Visus“ bezeichnet. Der Visus ist die Fähigkeit des Auges, zwei nah beieinander liegende Punkte getrennt voneinander wahrzunehmen. Der Ort, an dem die Sehschärfe bestimmt wird, ist die Netzhautmitte, wo im Punkt des schärfsten Sehens (Fovea centralis oder auch Gelber Fleck) die Zäpfchen für die Sehschärfe zuständig sind.
(aus Wikipedia
XXX)
Aus physikalischer Sicht wird ein Gegenstand für uns sichtbar, wenn das von einer Lichtquelle (z.B. Sonne, Lampe) ausgestrahlte Licht von diesem Gegenstand reflektiert wird. Diese reflektierten Lichtstrahlen werden in der Linse des Auges gebündelt, sodass auf der Netzhautmitte ein scharfes Bild entsteht. Das entstandene Bild steht auf dem Kopf. Die Lichtstrahlen treffen auf die Zapfen der Netzhaut. Die Informationen, die bei jedem Zapfen entstehen, so genannte elektrische Nervenimpulse, werden im gelben Fleck gesammelt und über den blinden Fleck an das Gehirn weitergeleitet. Dort entsteht das richtige Bild. (Abb1)
Damit man Gegenstände in der Nähe und in der Ferne scharf erkennen kann, wird die Linse gespannt oder gekrümmt. Um in der Nähe scharf zu sehen, wird der Ziliarmuskel angespannt und die Zonulafasern erschlaffen. Die Linse krümmt sich. Um Gegenstände in der Ferne scharf sehen zu können, erschlafft der Ziliarmuskel und die Zonulafasern spannen sich an. Die Linse wird flacher.
Um einen Gegenstand original- und detailgetreu erkennen zu können, spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Einmal muss das Objekt ausreichend groß sein und zweitens einen genügend hohen Kontrast aufweisen können. Ist dies nicht der Fall, kann das Auge den Gegenstand nicht mehr erkennen. Ein Beispiel dafür ist, dass wir tagsüber die Sterne am Himmel nicht sehen können, obwohl sie vorhanden sind, weil der Kontrast zu gering ist.
Um einen Gegenstand wirklich genau zu erkennen, müssen wir immer den Blick direkt auf ihn richten. Wenn der Gegenstand weiter am Rand unseres Blickfeldes liegt, dann sehen wir ihn nur noch unscharf.
Durch ständige kleine Augenbewegungen sorgen die Augen von sich aus dafür, dass immer wieder andere Bereiche der Umgebung scharf abgebildet werden. Am Ende aber setzt das Gehirn die verschiedenen Informationen zu einem Bild zusammen, das uns einheitlich farbig und scharf erscheint.
(von Dörring-Coen 2006/ Netdoktor2)
Auf der Bild 1 sieht man den Querschnitt eines Auges, das gerade einen Gegenstand fokussiert.
Abb1: Der Apfel reflektierten
Lichtstrahlen, die in der Linse des Auges gebündelt werden, sodass auf der
Netzhautmitte ein scharfes Bild entsteht. Das entstandene Bild steht auf
dem Kopf. Die Lichtstrahlen treffen auf die Zapfen der Netzhaut. Die
Informationen, die bei jedem Zapfen entstehen, die so genannte elektrische
Nervenimpulse, werden im gelben Fleck gesammelt und über den blinden Fleck
an das Gehirn weitergeleitet. Dort entsteht das richtige Bild.
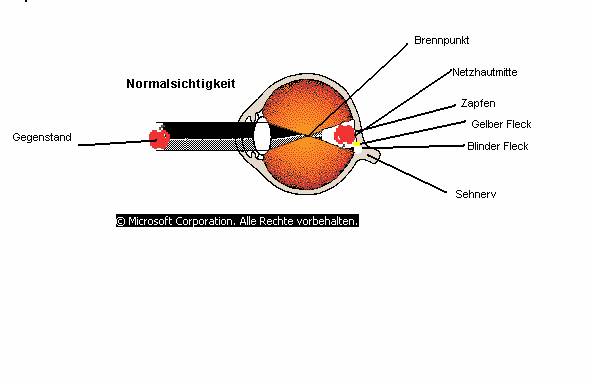
Bild 1: Titel des Bildes, aus: Microsoft Corporation 2000, Suchbegriff: Auge.
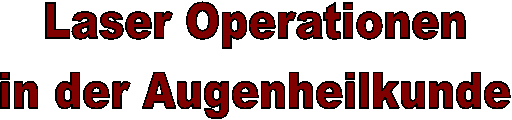
Heutzutage ist der
Laser eine wichtige Methode in der modernen Augenheilkunde, er schneidet,
verödet, schweißt und schleift auf einen Viertelmikrometer
genau.
Laser
Der Laser heißt mit vollem Namen Light amplification by stimulated emission of radiation). Man kann zwei Arten unterscheiden:
1. Der Excimer – Laser, ein Kaltlichtlaser, der punktgenaues Arbeiten ermöglicht. Durch den hohen Druck der Laserenergie wird das Gewebe zerstört und verdampft.
2. Der Holmium – Laser, ein Hitzelaser, der durch Hitze die Kollagenfasern des Hornhautgewebes zum Schrumpfen bringt.
Laser in der heutigen Augenheilkunde – eine Übersicht
- Behandlung von Fehlsichtigkeiten
- Brille und Kontaktlinse sind danach überflüssig
- Lasertherapie des Grünen Stars (Glaukom)
- Alternative nach Versagen der Medikamente
- Minimalinvasive Therapie
- die getrübte
Augenlinse wird durch eine Kunstlinse ersetzt, zuvor wird sie
durch den Laser verflüssigt
- Laserbehandlung gegen Netzhauterkrankungen
- Alternative zu der Operation am „offenen Auge“ durch ein Skalpell
- Anhalten von diabetischen Netzhauterkrankungen
- kann weitere Augenveränderungen durch Diabetes stoppen
(vgl. Butz 2003)
Laser - Operation
Eine Laser - Operation kommt nur für Patienten in Frage, auf die folgendes zutrifft:
- mindestens 20 Jahre alt (Wachstum ist abgeschlossen)
- eine seit längerem unveränderte Fehlsichtigkeit
- Unverträglichkeit Kontaktlinsen und Brillen gegenüber
- gesund
- keine Augenkrankheiten (z.B. Glaukom), Rheuma, Diabetes & chronische Hautkrankheiten, keine Wundheilungsstörungen
- sich der Risiken bewusst ist
Laser – Operationen werden vor allem bei Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Hornhautverkrümmung angewandt. Es gibt dabei zwei Verfahren, einmal das Hornhautverfahren, bei dem an der Hornhaut operiert wird, und zweitens das Linsenverfahren, bei dem an der Linse operiert wird bzw. eine Kunstlinse eingesetzt wird.
Je nach dem kann von mehr als –20,0 dpt. bis über +8,0 dpt. operiert werden. Dabei kommt es aber darauf an welches Verfahren man auswählt, denn es gibt etliche Formen der Laser – OP, die unter die zwei oben genannten Verfahren fallen. Eine Operation kann zwischen 1000€ und 2200€ kosten und sollte nur bei Spezialisten durchgeführt werden.
Wie bei jeder anderen Operation auch können bei einer Laser – OP Komplikationen auftreten, wie zum Beispiel:
- trockenes Auge
- Restfehlsichtigkeit nach der Operation
- instabile Hornhaut
- erhöhte Blendempfindlichkeit
Vor einer Laser - Operation wird der Patient
aber über die Risiken aufgeklärt. Dazu sollte vor der Operation ein sorgfältiger
Augentest sowie gute Aufklärung durchgeführt werden. Grundsätzlich
problematisch ist das Lasern während der
Schwangerschaft und der Stillzeit sowie bei Augenkrankheiten und bei akuten
Allergien.
(aus Lanner 2001, Butz 2003, Huber & Lackner 2001)

Bild1: Beispiel Kurzsichtigkeit – Das Bild ist im
Vordergrund scharf zu sehen, während es im Hintergrund jedoch unscharf ist (aus unbekannt1).
Kurzsichtigkeit
- Bei der Kurzsichtigkeit
oder Myopie (von griechisch: myein - (die Augen) schließen, Opia - die Sicht) kann man weit entfernte Objekte
schlechter sehen als nahe gelegene.
- Myopie ist eine
Form der Fehlsichtigkeit,
bei der der Fokus
schon vor der Netzhaut
liegt, das heißt, dass das Bild schon vor der Netzhaut entsteht. Sie ist somit
das Gegenteil der Hyperopie
(Weitsichtigkeit)
- Es gibt zwei
Formen der Kurzsichtigkeit : Die Brechungsmyopie
bei normaler Augapfellänge, aber zu starker Brechkraft, und die Achsenmyopie bei normaler Brechkraft, aber zu langem
Augapfel. Beide Ursachen sind genetisch bedingt.
- Eine Achsenmyopie ist viel häufiger als eine Brechungsmyopie.
Sie wird meist rezessiv vererbt. Die Achsenmyopie
entwickelt sich besonders in den ersten 30 Lebensjahren.
- Es kommt dabei zu
einer übermäßigen Verlängerung des Augapfels. Die Bedeutung äußerer Einflüsse,
wie zum Beispiel intensive Naharbeit oder viel Lesen, vor allem bei schlechtem
Licht, ist für die Entstehung mit verantwortlich. Neuere Untersuchungen zeigen
auch, dass eine schlechte Bildqualität auf der Netzhaut die Entwicklung der
Kurzsichtigkeit fördert.
- Die Brechungsmyopie kann durch eine vermehrte Krümmung der
Hornhaut oder der Linse, aber auch durch eine Erhöhung der Brechzahl der Linse
wegen Trübungen des Linsenkerns entstehen.
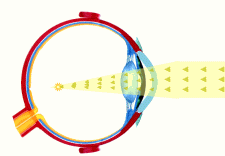 Bild
2: Brennpunkt vor der Netzhaut - Das Bild entsteht vor der Netzhaut,
da der Augapfel zu lang ist. Gegenstände in der Nähe können scharf gesehen
werden, mit zunehmender Entfernung werden Bilder jedoch unscharfer. (aus unbekannt2)
Bild
2: Brennpunkt vor der Netzhaut - Das Bild entsteht vor der Netzhaut,
da der Augapfel zu lang ist. Gegenstände in der Nähe können scharf gesehen
werden, mit zunehmender Entfernung werden Bilder jedoch unscharfer. (aus unbekannt2)
Autor: Wikipedia
2006a
Bild 3: Beispiel
Weitsichtigkeit – Der Hintergrund
des Bildes ist völlig scharf, während jedoch der Vordergrund nur verschwommen
zu erkennen ist. (aus unbekannt3)
Weitsichtigkeit
- Bei der in
der Umgangssprache Weitsichtigkeit genannten Übersichtigkeit, Hyperopie oder Hypermetropie ist der Augapfel
entweder zu kurz oder die Brechkraft
des Auges ist zu schwach. Kombinationen aus beidem sind ebenfalls möglich
- Dies führt dazu,
dass die Bildlage nicht auf der Netzhaut, sondern dahinter ist. Dadurch sieht
das Gehirn
unscharf.
- Durch Änderung
der Brechkraft
der Augenlinse kann die Weitsichtigkeit in jüngeren Jahren ausgeglichen werden.
Diese Fähigkeit geht aber mit zunehmendem Lebensalter (ab ca. 45) verloren und
endet mit der Alterssichtigkeit. Dann ist eine Lesebrille notwendig, um die fehlende Brechkraft zu
ergänzen.
- Übersichtigkeit
kann mit augenoptischen Mitteln (Brille, Kontaktlinsen)
korrigiert werden. In den letzten Jahren ist auch eine Behandlung mit einem
chirurgischen Eingriff durch Refraktive Chirurgie möglich geworden.
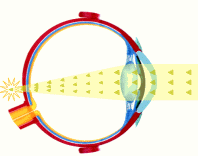 Bild
4: Brennpunkt hinter der Netzhaut - Das Bild entsteht hinter der
Netzhaut, da der Augapfel zu kurz ist. Gegenstände in der Ferne können dadurch
trotzdem scharf gesehen werden, je näher der Gegenstand jedoch rückt, desto
unscharfer wird er. (aus
unbekannt4)
Bild
4: Brennpunkt hinter der Netzhaut - Das Bild entsteht hinter der
Netzhaut, da der Augapfel zu kurz ist. Gegenstände in der Ferne können dadurch
trotzdem scharf gesehen werden, je näher der Gegenstand jedoch rückt, desto
unscharfer wird er. (aus
unbekannt4)
Autor: Wikipedia 2006b
Brillen
- Als Brillengläser
bezeichnet man Linsen für Sehhilfen aus Glas oder Kunststoff. Sie werden von
der optischen Industrie hergestellt. Der Augenoptiker
arbeitet die Brillengläser in die Brillenfassung ein. Ein Brillenglas hat eine optische Wirkung. Die
Brechkraft einer Brillenlinse wird Dioptrie (dpt) genannt.
- Es gibt so
genannte Plusgläser oder auch positive Gläser (sphärische Gläser). Mit
diesen Gläsern wird Hyperopie
(Übersichtigkeit, Weitsichtigkeit) korrigiert, da das Auge einen zu
geringen Brechwert besitzt. Diese Gläser haben eine sammelnde Wirkung und bekommen als Vorzeichen ein Plus (z.B. +0,75 dpt).
- Minusgläser sind negative Gläser (sphärische Gläser).
Damit wird Myopie (Kurzsichtigkeit) korrigiert, da in diesem Fall das
Auge einen zu hohen Brechwert besitzt. Diese Gläser haben eine zerstreuende Wirkung und bekommen als Vorzeichen ein Minus (z.B. -1,25 dpt).
- Außerdem gibt es
kombinierte Plus-Minus-Gläser, um alterssichtige Kurzsichtige zu korrigieren.
Das Plusglas ist dabei im unteren Teil des (meistens größeren)
Minus-Brillenglases eingelassen. Sind die Übergänge nicht sichtbar, spricht man
von Gleitsichtglas.
- Bei starker Kurzsichtigkeit wird durch eine Brille das gesehene verkleinert im vergleich zu einem
Normalsichtigen). Im Gegenzug wird
bei starker Weitsichtigkeit
das Gesehene vergrößert (gegenüber einem Normalsichtigen) also das Gesichtsfeld verkleinert. In allen Fällen
gibt es eine Beschränkung des Sehfelds durch den Brillenrand, und die Augen
können nicht ganz den natürlichen Bewegungsmustern
folgen.
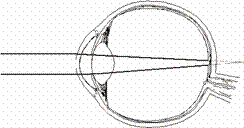
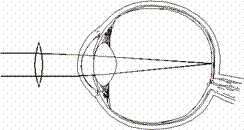
Bild5: Sehfehler bei
Weitsichtigkeit(aus
unbekannt5) Bild6: Korrigierte
Weitsichtigkeit – Sehfehler korrigiert durch eine Sammellinse (plus Gläser)
(aus unbekannt6)
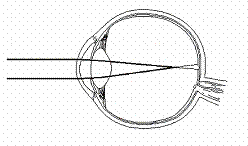
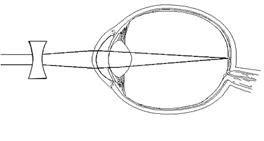
Bild7: Sehfehler bei
Kurzsichtigkeit (aus
unbekannt7) Bild8: Korrigierte
Kurzsichtigkeit – Sehfehler korrigiert durch Zerstreuungslinse (minus
Gläser) (aus
unbekannt8)
Autor: Wikipedia 2006c
Kontaktlinsen
Bild9: weiche
Kontaktlinse (aus
unbekannt9)Bild10: Kontaktlinse auf
dem Auge aufliegend (aus
unbekannt10)
1.Formstabile/harte Kontaktlinsen
- 1976 kamen die ersten
sauerstoffdurchlässigen, harten Kontaktlinsen auf den Markt. Durch
Weiterentwicklung der Kunststoffe gibt es
heute hochgasdurchlässige, hartflexible Linsen mit einer ca. zwei- bis
siebenmal höhere Gasdurchlässigkeit als weiche Kontaktlinsen
- Der Durchmesser der Linse liegt zwischen 8 und 10 mm. Sie schwimmen beweglich auf einem Tränenfilm. Daher gibt es ein geringeres Risiko der Schädigung des Auges, da das Auge besser mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden kann. Durch die heute aktuellen Linsen-Materialien geht ein sehr großer Teil des Nährstofftransports auch durch das Linsenmaterial hindurch: die Hornhaut wird besser mit Nährstoffen versorgt - selbst besser als das bei den weichen Linsen möglich ist.
- Durch verbesserte Messmethoden und
intelligentere Formgestaltung der Linsen sowie komfortablere Materialien ist
die Verträglichkeit verbessert worden. Durch Alterungsprozesse an der Linse
kann sich die Linse aber verformen und die Hornhaut schädigen: das Tragen überalterter Linsen
sollte vermieden werden.
- Fazit: die heutigen formstabilen Linsen sind längst nicht mehr hart sondern haben an Komfort und Verträglichkeit gewonnen. Formstabile Linsen sind den "weichen" Linsen heute in vielen Punkten überlegen.
2.Weiche Kontaktlinsen
- Weiche Kontaktlinsen (seit 1971) sind flexibel und passen sich der Form der Hornhaut an.
- Der Durchmesser liegt zwischen 12 und 16 mm, der Linsenrand liegt daher auch bei geöffnetem Auge unter dem Lidrand. Dadurch und durch die fast direkte Haftung auf der Augenoberfläche sitzen sie fester im Augeund das Verlustrisiko, z. B. bei Wassersport ist geringer.
- Viele Menschen finden das Tragen weicher Linsen angenehmer als das harter Kontaktlinsen. Das Risiko von Schädigungen des Auges durch Ernährungsstörungen, Ablagerungen auf der Linse, Sauerstoffmangel oder Schadstoffen im Wasseranteil der Linse ist aber höher als bei harten Linsen.
- Eine besondere Form der weichen Kontaktlinsen sind die Tageslinsen bzw. Tages-Kontaktlinsen. Sie werden einmalig benutzt und danach entsorgt.
- Durch die Weiterentwicklung weicher Kontaktlinsen, besonders bei der verbesserten Sauerstoffdurchlässigkeit bei den sogenannten Silikon-Hydrogel-Linsen, einer Erfindung des tschechischen Chemikers Otto Wichterle, werden inzwischen auch Kontaktlinsen angeboten, die mehrere Tage und Nächte getragen werden können. Erst nach dreißig Tagen müssen die Linsen gegen neue ausgetauscht werden. Allerdings raten Ärzte von einem ständigen Tag und Nachttragen ab, da sie darin eine gesundheitliche Gefährdung für die Augen sehen
- Linsen zur Korrektur von Kurzsichtigkeit sind physikalisch bedingt am Rande dicker als in der Mitte und daher bei hohen Stärken gewöhnungsbedürftiger
- Linsen zur Korrektur von Weitsichtigkeit werden zum Rand hin dünner. Bei starker Kurzsichtigkeit bieten Kontaktlinsen den Vorteil, dass das Gesehene aufgrund des direkten Sitzes auf dem Auge, anders als bei einer Brille, nicht verkleinert wird. Dadurch wird mit einer Kontaktlinse i.A. eine bessere Korrektur des Sehfehlers erzielt.
- Auch wird bei starker Weitsichtigkeit das Gesehene nicht vergrößert, gegenüber einem Normalsichtigen also das Gesichtsfeld nicht verkleinert.
- Risiken und Nebenwirkungen: Eine falsche Kontaktlinse reduziert die Versorgung der Hornhaut mit Nährstoffen, es besteht dadurch ein größeres Risiko, einen Infekt zu bekommen, die Hornhaut quillt auf, es kann zu dauerhaften Trübungen der Hornhaut kommen oder es tritt eine Überempfindlichkeit auf. Es werden keine Linsen mehr vertragen.
Autor: Wikipedia 2006
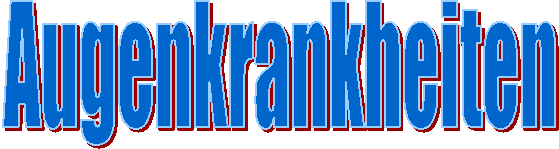
Die Bindehautentzündung
Die
Bindehautentzündung oder „Konjunktivus“ ist die
häufigste Erkrankung des Auges überhaupt. Sie kann durch von außen kommende
oder – viel seltene – von innen stammende Reize entstehen.
Die Ursachen können allergische Reaktionen wie bei Heuschnupfen, Entzündungen durch Fremdkörper, Augentrockenheit, reizende Substanzen, die ins Auge gelangen, oder übertragbare Formen, die durch Bakterien und Viren ausgelöst werden, sein. Manchmal ist die Bindehautentzündung auch Symptom einer zugrund liegenden rheumatischen Erkrankung.
Die Symptome der Bindehautentzündung sind ein „rotes Auge“, Fremdkörpergefühl, Jucken, Brennen und verstärkte Sekretion mit Verkleben der Augenlider am Morgen. Lichtempfindlichkeit und stärkere Schmerzen deuten auf die Beteiligung der Hornhaut hin.
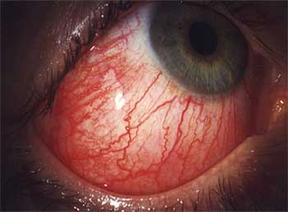
Abb. 1: Das stark gerötete Auge bei einer
Bindehautentzündung (aus: siehe Literaturverzeichnis)
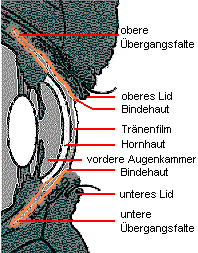
Abb. 2 (aus: siehe Literaturverzeichnis)
Die Lage der Bindehaut macht sie besonders empfänglich für Reize und Keime von außen. Für Keime ist sie die Eintrittspforte in den Körper.
Die Bindehaut wird meistens als eine milde Erkrankung gesehen, da die Blutversorgung, die hohe Reaktionsfähigkeit auf Entzündungen, der reiche Besatz an immunkompetenten Zellen und die Abwehrenzyme der Tränenflüssigkeit die wichtigsten Vermittler einer guten Abwehrfunktion sind. Doch es können auch schwere Formen auftreten, die das gesamte Auge und damit das Sehvermögen bedrohen.
Die Bindehautentzündung wird je nach Ursache mit antibiotischen, antiallergischen, kortisonhaltigen oder wirkstoffreichen Augentropfen behandelt.
Autor: Onmeda
Das Gerstenkorn
Bei einem Gerstenkorn („Hordeolum“) handelt es sich
um eine akute Eiteransammlung in den Liddrüsen des Auges.
Man unterscheidet zwischen zwei Arten, dem
„Hordeolum internum“ und dem „Hordeolum externum“. Bei dem „Hordeolum internum“
handelt es sich um eine eitrige Entzündung an der Lidinnenseite des Auges, die
unter Umständen nicht direkt sichtbar ist. Bei dem „Hordeolum externum“ hanedlt es sich um eine
Entzüdnung im Bereich der Lidkante oder der Wimpern.
Das Gerstenkorn wird meist durch Bakterien, die ins
Auge eindringen.

Abb. 3:
Ein Gerstenkorn, nachdem die schmerzhafte allgemeine Lidschwellung sich auf einen Punkt konzentriert hat.
Zu Beginn zeigt sich ein Gerstenkorn durch Rötung,
später durch eine druckschmerzhafte Schwellung der betroffenen Stelle des
Auges. Von der Schwellung geht es in eine kleine Eiteransammlung mit
Spannungsgefühl über.
In der Regel platzt ein Gerstenkorn nach Tagen von
selbst auf und die Entzündung heilt ab.
Autor: Onmeda
Grauer Star
Grauer Star oder „Katarakt“ sind Augenkrankheiten, die durch eine Trübung der Augenlinse gekennzeichnet sind. Sie ist die weltweit häufigste Erblindungsursache, wobei es sich bei 90% der Fälle um eine Alterskatarakt handelt.
Da es ein langsam fortschreitender Prozess ist, fühlt sich der Patient erst im späteren Stadium beeinträchtigt. Die Symptome sind unscharfes, mattes, verschleiertes und verzerrtes Sehen, Kontraste verlieren an Schärfe und Farben an ihrer Leuchtkraft. Einige Betroffenen haben starke Blendungserscheinen in der Sonne oder nachts bei entgegenkommenden Autoscheinwerfern.
Manche kommen plötzlich ohne ihre Lesebrille auskommen, da sich die Brechungseigenschaft der Linse durch die Linsentrübung verändert. Manche werden kurzsichtig und sehen gelegentlich Doppelbilder.


Abb. 4
Eine Simulation des grauen Stars
Eine gesicherte medikamentöse Therapie zur Rückbildung des grauen Stars gibt es nicht. Es muss eine Operation erfolgen, um die Sehkraft zu verbessern.
Autor: Onmeda
Grüner Star
Unter dem grünen Star oder „Glaukom“ versteht man Augenkrankheiten, die in er Regel durch einen erhöhten Augendruck den Sehnerv beschädigen. Dies kann zu Gesichtsfeldausfällen und Erblindung führen. 1% der Bevölkerung leidet am grünen Star, wobei das Risiko im höheren Alter ansteigt. Da sich der grüne Star schleichend und unbemerkt entwickelt, wird ab dem 40. Lebensjahr eine regelmäßige „Glaukom-Früherkennung“ empfohlen.
Man unterscheidet zwischen verschiedene Formen des Glaukoms.
1. Das primäre Offenwinkelglaukom macht für lange Zeit keine Beschwerden. Es kann aber früh erkannt und mit Augentropfen sehr gut behandelt werden. Bei hohem Augeninnendruck können durch ein sogenanntes Epithelödem (Wassereinlagerungen in der Hornhaut) farbige Ringe oder Höfe um Lichtquellen auftreten. Später kann es zu Gesichtsfelddefekten oder zur völligen Erblindung kommen.
2. Das akute Glaukome kann man durch ein rotes, steinhartes Auge mit lichtstarrer Pupille erkennen. Der betroffene empfindet Schmerzen und Sehstörungen. Häufig kommen noch Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen dazu.
3. Das primäre kongenitale Glaukom erkennt man durch lichtscheue, tränende Augen und Lidkrampf bei betroffenen Kindern. Bei sehr großen Augen von Säuglingen kann ein Verdacht bestehen und man sollte einen Facharzt rufen.
4. Das sekundäre Glaukom kann Folge einer anderen vorherigen Augenerkrankung sein. Sollten Augentropfen nicht ausreichen, muss eine Behandlung mit dem Laser oder einer Operation erfolgen.


Abb. 5:
Simulation des Glaukoms
Autor: Onmeda
Literaturverzeichnis
Bartschneider, Markus:
Alterssichtigkeit: Linse mit hartem Kern.- NetDoktor.de GmbH,
München, 2006, Online:
http://www.netdoktor.de/krankheiten/fokus/auge_altersweitsichtigkeit.htm,
zuletzt aufgerufen: 15.2.2006
Butz, Katharina: Augenlaser: 100%
Sehkraft ohne Brille.- 89 S., Rowohlt Taschenbuch
Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, 2003.
Döring-Coen, Christine: Sehtest.- NetDoktor.de GmbH, München, 2006, Online:
http://www.netdoktor.de/ratschlaege/untersuchungen/sehtest.htm, zuletzt
aufgerufen: 10.02.2006.
Huber, Irmgard & Lackner,
Wolfgang: Augenlaser – Die
Erfolgstherapie bei Fehlsichtigkeit.- 96 S., Südwest
Verlag, München, 2001.
Lanner,
Oliver: Klare Sicht – Nie wieder Bille.- NetDoktor.de GmbH,
München, 2001, Online:
http://www.netdoktor.de/feature/laser.htm, zuletzt aufgerufen am 09.02.2006
Mann: Online:
http://www.mannpharma.de/auge/wunder_des_sehens/wie_wir_sehen/sehschaerfe.htm,
zuletzt aufgerufen: 10.02.2006
Microsoft Corporation XXX
Microsoft Corporation: Encarta
2000, CD-Rom, …
Netdoktor1
Online
http://www.netdoktor.de/krankheiten/fokus/auge_altersweitsichtigkeit.htm )
http://www.netdoktor.de/ratschlaege/untersuchungen/sehtest.htm
Psychrembel: Klinisches Wörterbuch, 259.
Auflage, Walter de Gruyter Verlag, Berlin, 2002
Bild1:
www.mpge.de/welt/ bessersehen03.htm
Bild2:
humanvision.ch/ fachbegriff_inhalt.html
Bild3:
www.mpge.de/welt/ bessersehen03.htm
Bild4: humanvision.ch/
fachbegriff_inhalt.html
Bild5: http://www.klinikum-dessau.de/klinik/klinikde/kl_ak/pics/linse_weik.gif
;
Bild6:
http://www.klinikum-dessau.de/klinik/klinikde/kl_ak/pics/linse_wei.gif
;
Bild7: http://www.klinikum-dessau.de/klinik/klinikde/kl_ak/pics/lins_kur.gif
Bild8:
http://www.klinikum-dessau.de/klinik/klinikde/kl_ak/pics/lins_kurk.gif
Bild9:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/a/a5/Kontaktlinse_1.JPG/180px-Kontaktlinse_1.JPG
Bild10:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/9/9b/Kontaktlinse_2.JPG/180px-Kontaktlinse_2.JPG
Wikipedia – Kontaktlinsen – Gesellschaft zur Förderung Freien
Wissens e. V., D-10795 Berlin, 2006d, Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Kontaktlinsen,
Zuletzt aufgerufen am 06.03.06
Wikipedia – Weitsichtigkeit – Gesellschaft zur Förderung
Freien Wissen e.V., D-10795 Berlin, 2006b, Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Weitsichtigkeit,
Zuletzt aufgerufen am 06.03.06
Wikipedia: Kurzsichtigkeit. - Gesellschaft zur Förderung
Freien Wissens e.V., D-10795 Berlin, 2006a, Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Kurzsichtigkeit
Wikipeia – Brillenglas – Gesellschaft zur Förderung Freien
Wissens e.V., D-10795 Berlin, 2006c, Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Brillenglas,
zuletzt aufgerufen am 06.03.06
Zuletzt aufgerufen am:
06.03.06
Onmeda – Augenkrankheiten. –
Bindehautentzündung. – OnVista Media GmbH, D- 51449
Köln, 2006, Online:http://www.onmeda.de/krankheiten/bindehautentzuendung.html,
zuletzt aufgerufen: 16/03/2006
Onmeda – Augenkrankheiten. –
Gerstenkorn. – OnVista Media GmbH, D-51449 Köln,
2006, Online: http://www.onmeda.de/krankheiten/gerstenkorn.html,
zuletzt aufgerufen: 16/03/2006
Onmeda – Augenkrankheiten. –
Grauer Star. – OnVista Media GmbH, D-51449 Köln,
2006, Online: http://www.onmeda.de/krankheiten/grauer_star.html,
zuletzt aufgerufen: 16/03/2006
Onmeda – Augenkrankheiten. –
Grüner Star. – OnVista Media GmbH, D-51449 Köln,
2006, Online: http://www.onmeda.de/krankheiten/gruener_star.html,
zuletzt aufgerufen: 16/03/2006
Abb.1
http://www.onmeda.de/krankheiten/bindehautentzuendung.html.?p=2
Abb.2:http://www.medizinfo.de/augenheilkunde/images/lidanatomie.gif
Abb.3:http://www.augeonline.de/Erkrankungen/Liderkrankungen/Gerstenkorn_Hagelkorn/Hordeolum450.JPG
Abb. 4:http://www.bbsb.org/bilder/sehbehinderungensimulator/k3.jpg
Abb. 5:http://www.bbsb.org/sehbehinderungensimulator/k5.jpg


